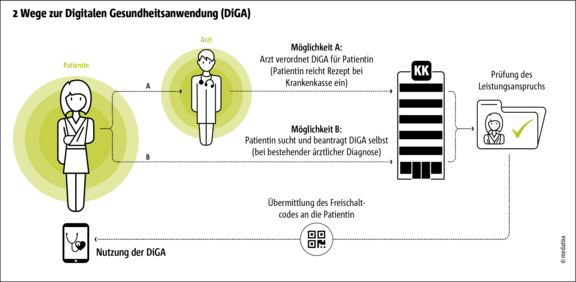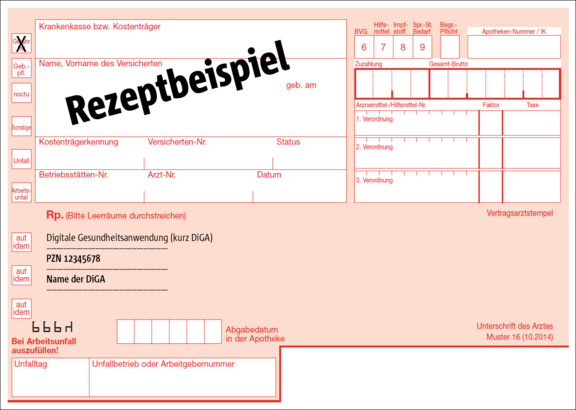Für im DiGA-Verzeichnis des BfArM aufgeführte vorläufig aufgenommene Anwendungen, für die das BfArM ärztliche und/oder psychotherapeutische Tätigkeiten festgelegt hat, kann für die Verkaufskontrolle und Auswertung die Pauschale 86700 (7,93 Euro) abgerechnet werden. Sie kann pro DiGA einmal im Behandlungsfall abgerechnet werden. Im Krankheitsfall kann die Pauschale pro DiGA höchstens zweimal abgerechnet werden, sofern die GOP 01470 für die Erstverordnung derselben DiGA nicht angewendet wurde.
Für die Dauer des Erprobungszeitraums der DiGA kann die Pauschale berechnet werden, die Vergütung erfolgt extrabudgetär.
Die Abrechnung der Pauschale im Rahmen einer Videosprechstunde ist nicht möglich, da einige der DiGA Daten und Arztberichte lediglich als PDF oder in der App darstellen und Verlaufskontrolle und Auswertung in der Videosprechstunde nicht erfolgen kann.
Folgende Fachgruppen können die Pauschale 86700 abrechnen:
- Hausärztliche Tätigkeit
- Kinder- und Jugendmedizin (Fachgruppen mit Zusatzweiterbildung Kinder- und Jugend-Orthopädie oder Zusatzweiterbildung Kinder- und Jugend-Rheumatologie)
- Innere Medizin (inklusive Fachgruppen mit Teilnahme an Onkologie-Vereinbarung)
- Gynäkologie
- Orthopädie und Unfallchirurgie
- Chirurgie (ohne Plastische und Ästhetische Chirurgie)
- Physikalische und Rehabilitative Medizin
- Fachgruppen und Psychotherapeutinnen und -therapeuten, die nach Kapitel 16, 21, 22 und 23 des EBM Leistungen berechnen dürfen, sowie Fachgruppen mit Zusatzweiterbildung Psychotherapie
- Im Rahmen der Qualitätssicherungsvereinbarung zur schmerztherapeutischen Versorgung chronisch schmerzkranker Patientinnen und Patienten mit Genehmigung der KV durch Ärztinnen und Ärzte.